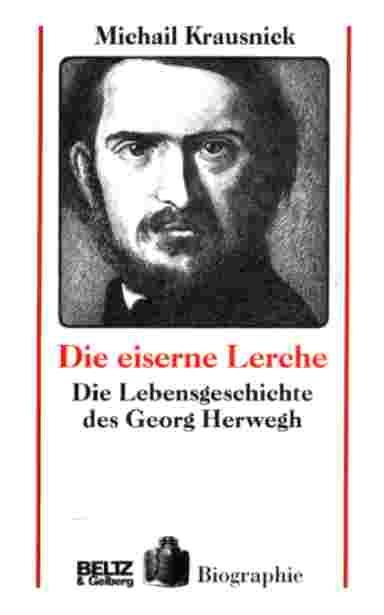Dichter und Rebell
Gulliver-Taschenbuch
773
ISBN
3-407-78773-1 , € 7,45
BELTZ
& GELBERG
In
enger Verbindung von Leben und Werk gelingt Krausnick eine
einfühlsame, differenzierte Annäherung an den Menschen und
Dichter.
Jurybegründung
zum Deutschen Jugendliteraturpreis
Anschaulich
beleuchtet Krausnick zugleich ein Stück deutscher Geschichte. Eine
kritische Biographie, die sich auch dadurch auszeichnet, dass sie Emma
Herwegh so stark miteinbezieht.
Frankfurter
Rundschau
Alfred Georg Frei
als
Klett-Leseheft
mit
zusätzlichen Materialien
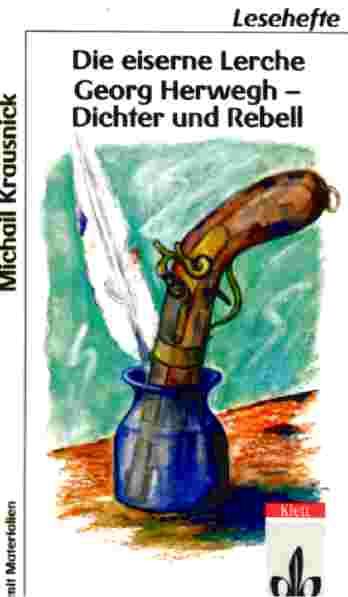 ISBN
3-12-262230-0
ISBN
3-12-262230-0
ERSTAUSGABE
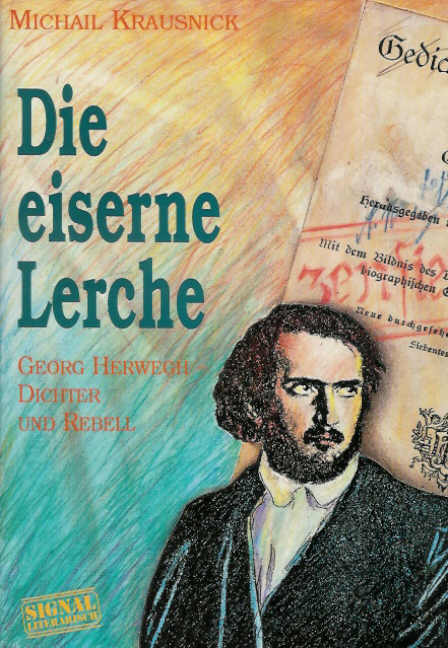
Neu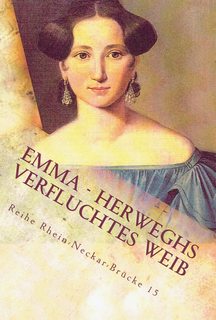
Emma -
Herweghs verfluchtes Weib
Nicht Magd
mit den Knechten!
Die
Lebensgeschichte
einer revolutionären Frau
von Michail Krausnick
194 Seiten, über 50 Abb.
Reihe Rhein-Neckar-Brücke 15
9,70 €
ISBN
9781517457822
NEU
auch als Hardcover
192 Seiten mit 40 schwarz-weiß und11 farbigen Abbildungen

19,80 Euro
ISBN
978-3738635966
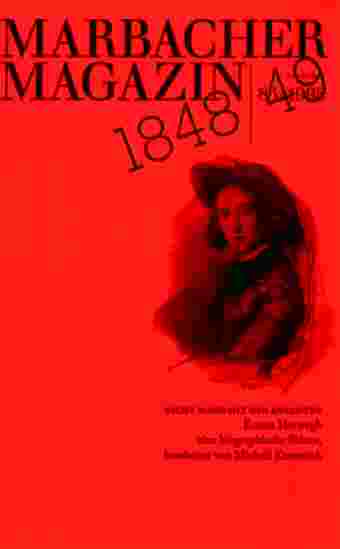
(Erstausgabe
als Marbacher Magazin der Deutschen Schillergesellschaft/ vergriffen)
Das
Porträt
einer außergewöhnlichen Frau, in den besten Berliner Kreisen
zuhause, wohlbegütert und hoch- begabt, die sich in die
Gedichte
des politischen Lyrikers Georg Herwegh verliebt, mit ihm in
Männerkleidern
1848 aktiv am Revolutionsgeschehen beteiligt und die (im
Gegensatz
zu anderen Alt-48ern und den literarisch gewendeten Zeitgeistern
unserer Tage) für aufrechten Gang und demokratische Ideale Not und
Exil in
Kauf nimmt. Sie lebte und dachte selbstbewusst, europäisch und
revolutionär.
Zu ihren Freunden, Gesprächs- und Briefpartnern zählten
Lassalle, Mieroslawski, Bakunin, Garibaldi, Orsini, Feuerbach, Hecker,
Wedekind u.v.a.
DIE ZEIT -
Zeitläufte 

Amazone
der Freiheit
Das Leben der Emma Herwegh – Republikanerin,
Kämpferin,
große Liebende. Und für eine Nacht des Jahres 1848 die erste
Heerführerin
der deutschen Geschichte
Von Michail Krausnick
Paris im Frühjahr 1893. Ein junger Mann, Schriftsteller
aus
Deutschland, eilt durch die Stadt, in die Rue des Saints-Pères
No
40. Er hat die Adresse gerade erst bekommen, kann sich kaum vorstellen,
dass
die Frau, die er sucht, überhaupt noch lebt. Dass es sie
überhaupt
gibt, diese legendäre Gestalt, die einst, vor bald einem halben
Jahrhundert,
in Männerkleidern für Freiheit und soziale Gerechtigkeit das
Leben
wagte: »Und durch Europa bahnen wir / der Freiheit eine
Gasse!«
Frank Wedekind, der junge Mann, findet die alte Dame, Emma
Herwegh,
gesund und heiter in der Straße der heiligen Väter. Sie gibt
ihm
Sprachunterricht, lektoriert sein Stück Die Büchse der
Pandora,
prüft die französischen Passagen. Sie erkennt sofort sein
außergewöhnliches
Talent. Die 76-Jährige bemuttert und berät den
28-Jährigen,
verwöhnt ihn mit Datteln, Marzipan, mit Rum und Zigaretten. Auf
dem
Sofa der ärmlichen Mansardenwohnung entwickelt sich eine
»merkwürdig
schöne Vertrautheit«, oft geht der Blick zurück.
Früh war sie eine Persönlichkeit, die junge Emma Siegmund,
geboren
am 10. Mai 1817 als Tochter des Berliner Seidenwarenhändlers und
Hoflieferanten
Johann Gottfried Siegmund, und eine der begehrtesten Partien der Stadt.
Charmant,
umfassend gebildet, nicht zuletzt ausgestattet mit einer üppigen
Mitgift.
Von akademischen Lehrern privat erzogen, beherrschte sie sieben
Sprachen,
musizierte, zeichnete, schrieb Gedichte. Die Familie wohnte
vis-à-vis
dem Schloss, führte einen glänzenden Salon; wenn Emma
Schnupfen
hatte, kam der Leibarzt des Königs. Was sie keineswegs hinderte,
den
bornierten Nachbarn von Herzen zu hassen. Beim Bogenschießen im
Park,
berichteten Vertraute, habe sie am liebsten auf Abbilder des
Preußenkönigs
oder des russischen Zaren gezielt: in tyrannos – gegen die
Unterdrücker
der deutschen und der polnischen Freiheit.
Emma ritt wie der Teufel, schoss mit Pistolen, schwamm bei Mondschein
in
Flüssen und Seen, turnte, rauchte. Sie besuchte die rapide
wachsenden
Elendsviertel Berlins und betreute Polens Freiheitskämpfer im
preußischen
Gefängnis. In ihren eigenen Kreisen fühlte sie sich kaum noch
zu
Hause. Sie bekam Wutanfälle, schmiss Türen, mischte sich in
die
Gespräche der Offiziere und Minister. Machte ironische
Bemerkungen.
Vergraulte die Bewerber. In ihren Tagebüchern lässt sie ihrem
Hohn
über das Berliner Männermaterial freien Lauf:
»Beamtenseelen«,
»Philister«, »liberales Pack«, »fahle
Brut«,
»Hofschranzen«, »Speichellecker«. Nur ein
Künstler
oder Freiheitskämpfer kam für sie als Gefährte in
Betracht.
Ein Zurück hinter die Tage der Französischen Revolution
konnte
sie sich nicht vorstellen.
»Und wo es noch Tyrannen gibt, die laßt uns keck erfassen!
/
Wir haben lang genug geliebt, wir wollen endlich hassen!« Als
Emma
Siegmund 1841 diese Verse zum ersten Mal las, habe sie es sofort
gespürt
und vor der Familie ausgerufen: »Das ist die Antwort auf meine
Seele!«
Dabei wusste sie damals so gut wie nichts über den Verfasser,
nicht,
wie er aussah, nicht einmal seinen Namen. Denn das Bändchen, das
in
ganz Deutschland Furore machte wie kein Werk seit Schillers
Räubern,
war anonym erschienen: Gedichte eines Lebendigen. Erst nach und nach
sickerte
durch, dass er Schwabe sei, im Schweizer Exil leben müsse, da er
sich
als Rekrut geweigert habe, Loblieder auf den König zu singen und
im
Stuttgarter Opernhaus »württembergische Uniformen« zu
grüßen.
Mit Ferdinand Lassalle plant sie die Erstürmung
des
Vatikans
Rasend schnell hatte sich dieser Namenlose einen Namen gemacht.
Unerhört
waren seine Töne: »Reißt die Kreuze aus der Erden, /
alle
sollen Schwerter werden!« Obgleich die Gedichte sofort verboten
waren,
ließen sie den 24-jährigen Georg Herwegh im Nu zum
erfolgreichsten
Lyriker seiner Zeit werden; man schmuggelte sie ein, verkaufte sie
unterm
Ladentisch, sie wurden abgeschrieben, auswendig gelernt, gesungen.
Theodor
Fontane, Gottfried Keller und Karl Marx, alle im selben Alter wie der
Dichter,
gehörten zu seinen begeisterten Lesern. Seine größte
Bewunderin
freilich war Emma Siegmund. Unter dem Vorwand, unbedingt ein
Porträt
von ihm zeichnen zu müssen, setzte sie alles daran, ihren
Papiergeliebten
nach Berlin zu locken.
50 Jahre später in Paris – die Mansarde ist wie ein kleines
Herwegh-Museum
eingerichtet. Berühmte Gestalten blicken aus goldenen Rahmen auf
Wedekind
herab: Victor Hugo, Friedrich Hecker, Garibaldi, Franz Liszt,
Feuerbach,
Fanny Lewald, George Sand, Marie d’Agoult – nahezu das ganze
Jahrhundert
ist versammelt. Nur Marx, Heine und die (späteren) Intimfeinde
Herzen
und Wagner müssen in der Schublade bleiben.
Im Mittelpunkt er, der vergötterte Gatte. Ein Foto auf dem
Schreibtisch
zeigt ihn kurz vor seinem Tod 1875, lächelnd, mit Vollbart,
keineswegs
verbittert, eher philosophisch versonnen. Der Vergessene, im neuen
deutschen
Kaiserreich Verbotene. Ein großes Ölgemälde dagegen
erinnert
an den jungen »Lebendigen«, verträumt-romantisch in
die
Ferne blickend, wo die Freiheit wohnt.
Herwegh, im Herbst 1842 ohnehin auf einer Tournee (die zum Triumphzug
wurde)
im zwischenzeitlich etwas liberaler gestimmten Preußen, nahm Emma
Siegmunds
ungewöhnliche Offerte an. Und schloss – es war Liebe auf den
ersten
Blick – sieben Tage später bereits die Verlobung mit seiner drei
Wochen
älteren Verehrerin. »Das Mädchen ist noch rabiater als
ich
und ein Republikaner von der ersten Sorte!«, jubelte der
Bräutigam.
Und die Braut versprach: »Schatz, wenn Krieg wird, zieh’ ich mit,
mein
Reiten soll mir zu statten kommen, das soll eine Schlacht werden!«
Zunächst aber mussten beide fliehen. Die Könige von
Preußen,
Sachsen und Württemberg ergriff ein dunkles Unbehagen angesichts
der
rebellischen Kraft, die aus Herweghs Liedern drang, und verbannten den
jungen
Dichter ein für alle Mal aus deutschen Landen. Anfang März
1843
hatte das Paar in der Schweiz geheiratet, in Paris fanden es Asyl. Eine
zunächst
geplante Wohngemeinschaft mit Jenny und Karl Marx und dem Publizisten
Arnold
Ruge und dessen Frau scheiterte, doch Emmas Mitgift ermöglichte
eine
eigene Wohnung. Bald schon blühte der Salon, Turgenjew, Heine,
Bakunin
diskutierten hier, Victor Hugo, George Sand und viele andere Politiker
und
Künstler.
Während ihr Mann literarisch-politische Zeitschriften plante,
seine
Gedichte und Essays schrieb, übersetzte die polyglotte Emma die
Aufrufe
ihrer polnischen, russischen und italienischen Freunde und soll – laut
Spitzelbericht–,
auf einem Wirtshaustisch stehend, vor deutschen Handwerkern
sozialistische
Reden gehalten haben.
Im Pariser Exil weitete sich der Blick der Flüchtlinge. Soziale
Fragen
wurden debattiert, europäische Ideen, und die Utopie einer
gerechten
Weltordnung entwickelt. Emma Herwegh führte fleißig
Tagebuch.
Dort finden sich allerdings auch erste Tränenspuren. Andere Frauen
wie
die Gräfin d’Agoult erhoben ebenfalls Anspruch auf den so poetisch
aussehenden
Poeten, überzeugt, dass er ganz der Freiheit gehöre, auch der
erotischen.
Emma, die in jener Zeit drei Kinder zur Welt brachte, eine Tochter und
zwei
Söhne (einer starb im Säuglingsalter), versuchte tapfer zu
sein
und hoffte, dass alles radikal anders würde, nach der Revolution.
Und 1848 kam sie, die Revolution. In nur drei Februartagen befreiten
sich
die Franzosen vom korrupten Regime des
»Bürgerkönigs«
Louis Philippe. Auch Deutsche standen in Paris auf den Barrikaden.
Schwarz-Rot-Gold
wehte vereint mit der Trikolore und anderen europäischen
Freiheitsfarben.
Mehr als 60000 Deutsche lebten dort. Politisch Verbannte – und
»Wirtschaftsflüchtlinge«:
Handwerker und verarmte Bauern, die in den Manufakturen ihr Brot
suchten.
Als wenig später Volksaufstände auch Berlin, Dresden und Wien
erschütterten,
wollten viele von ihnen zurück und sich in der Heimat eine bessere
Zukunft
erkämpfen. Zum Anführer ihrer Demokratischen Legion aber
wählten
sie keinen Offizier, sondern einen Dichter. »Frisch auf mein
Volk,
mit Trommelschlag, im Zorneswetterschein!« hatte dieser
geschrieben:
»O wag es doch nur einen Tag, ein freies Volk zu sein!«
Militärische
Erfahrung hatte Georg Herwegh allerdings lediglich als Deserteur, doch
wen
störte das?
Emma Herwegh kramt in ihren Schubladen und Schachteln, zeigt Wedekind
die
Reliquien von 1848: die Revolutionskokarde, einen Samtfetzen vom Thron
des
Louis Philippe. Wedekind ist fasziniert von dieser Frau. Fast
täglich
sitzt er auf ihrem Sofa (bevor er zu seinen jüngeren Freundinnen
geht,
»Liebe machen«). Er führt sie aus, feiert Silvester
mit
ihr. Wie intensiv die Beziehung mit der Zeit wird, verrät sein
Tagebuch.
Sie lästern, klatschen, amüsieren sich. Mit Wut und
Ohnmachtsanfällen
reagiert Wedekind dagegen auf Emmas jüngsten Sohn Marcel, den erst
1858
Geborenen, gerade mal sechs Jahre älter als er selbst. Wedekind
ist
nahezu eifersüchtig auf den von Emma verhätschelten
Violinisten
– der wiederum spottet über den merkwürdigen
»Geliebten«
seiner Mutter.
Plötzlich dreht sie sich um und hat zwei Pistolen in der Hand.
Wedekind
zuckt zusammen. Es sind die berühmt-berüchtigten, mit denen
sie
1848 in den Freiheitskampf zog. Aber sie hat noch mehr
Erinnerungsstücke.
Das wichtigste: ein Buch aus jener Zeit, ihr erstes und einziges, die
Geschichte
der deutschen demokratischen Legion aus Paris. Auf die Nennung ihres
Namens
hat sie verzichtet. Es sei ihr nicht um Ruhm gegangen. Einzig und
allein
»im Interesse der Wahrheit« habe sie geschrieben, gegen die
Verleumder.
Kaum gedruckt, sei das Büchlein schon verboten und beschlagnahmt
gewesen.
Einige Exemplare konnte sie retten. Eins schenkt sie ihrem jungen
Freund.
Wedekind verspricht, einen Verleger zu finden.
Es ist die Geschichte jenes Frühjahrs 1848. Nach tagelangen
Fußmärschen
sammelten sich die Legionäre in Straßburg, um über den
Rhein
zu setzen und gemeinsam mit Friedrich Hecker, dem Anwalt aus Mannheim,
die
Republik zu erkämpfen. Doch am deutschen Ufer wurde bereits
kräftig
die Franzosenangst geschürt. Die zensierte Presse verbreitete,
französische
Banditen wären plündernd und brennend in Baden eingefallen.
Emma und Georg Herwegh antworteten mit Flugblättern: »Wir
sind
keine Freischaren! Wir sind deutsche Demokraten, wollen alles für
das
Volk! Wir wollen die deutsche Republik!« Hecker zögerte, die
Hilfe
anzunehmen. Die Hetzkampagne hatte Wirkung getan.
Emma Herwegh übernahm die Initiative. Getarnt ging sie über
den
Rhein und durchquerte die feindlichen Linien. Zu Fuß, zu Pferd,
zu
Esel, mit der Bahn und auf Leiterwagen. Sie fand Hecker in seinem
Hauptquartier
und verabredete die Vereinigung der Heerscharen. Zurück in
Straßburg,
erwartete sie eine Enttäuschung: Innerhalb weniger Tage war die
Legion
stark zusammengeschmolzen. So blieben nur 649 Männer und eine
Frau,
die am 24. April 1848 über den Rhein setzten und auf den
schneebedeckten
Schwarzwald zumarschierten. Doch als die Legion den verabredeten
Treffpunkt
erreichte, war Heckers Freiheitsheer bereits geschlagen und in
Auflösung
begriffen.
Die Herweghs mussten die Legion retten, in der Schweiz neu sammeln.
Gejagt
von preußischen, hessischen und württembergischen Soldaten,
versuchten
sie, in nächtlichen Gewaltmärschen auf steilen Gebirgspfaden
durch
Schnee und Morast zu entkommen. Emma, zwei Pistolen und einen Dolch im
Gürtel,
marschierte in vorderster Reihe, schmierte im Nachtquartier die Brote,
diskutierte
mit.
Nach drei Tagen und Nächten erreichten sie das
Schwarzwaldstädtchen
Zell. Während ihr Mann und die Offiziere im Wirtshaus die schier
aussichtslose
Lage berieten – die feindlichen Truppen standen vor der Stadt –, wusste
Emma
Herwegh, was zu tun war. Es gelang ihr, über die Köpfe der
Militärs
hinweg, die Legionäre zum Weitermarschieren zu bewegen. Für
eine
Nacht wurde sie zur ersten Heerführerin der deutschen Geschichte.
In
einem strapazenreichen Marsch leitete sie die kleine Streitmacht auf
schmalen
Pfaden unversehrt durch die feindlichen Reihen.
Am nächsten Morgen jedoch, dem 27. April 1848, wurde die Legion
kurz
vor der Schweizer Grenze von württembergischen Truppen gestellt
und
in die Zange genommen. Es kam zu einem ungleichen Gefecht, bei dem die
übermüdeten
Freiheitskämpfer ihren ganzen Mut bewiesen, am Ende jedoch
geschlagen
wurden. 30 Männer starben.
Für Georg, die »Bestie«, und sie, »Herweghs
verfluchtes
Weib«, blieb wie für die meisten nur die Flucht. Ihr Buch
hat
den Kampfgefährten, den Gefallenen, den Eingekerkerten, den ins
Exil
Gegejagten ein Denkmal gesetzt. »Es giebt ein junges,
demokratisches
Deutschland! Ein Deutschland, das mit der alten Welt und ihren
Sünden
abgeschlossen hat […]. Diesem Deutschland allein übergebe ich
diese
Schrift […]. So viel Kämpfe ihm auch noch bevorstehen mögen,
so
viel seiner besten Kinder auch noch als Opfer des Despotismus fallen
werden,
ehe es Sieger bleibt, – es weiß, daß es später oder
früher
siegen muss …«
Ihr Buch werde niemals erscheinen, das habe sie schon beim Schreiben
geahnt,
erfährt der junge Wedekind. Schon im Sommer 48 war der Sieg der
Reaktion
nahezu perfekt, trotz des emsig vor sich hin tagenden
Paulskirchenparlaments.
Und spätestens nach dem Fall Wiens und der standrechtlichen
Ermordung
Robert Blums am 9. November geriet die demokratische Revolution
völlig
in die Defensive. Der Aufstand in Baden, in der Pfalz, im Rheinland und
in
Dresden ein halbes Jahr später konnte nichts mehr retten.
Der Niederlage folgte die Rache der Reaktion, auch in der eigenen
Familie.
Emma wurde enterbt. Das Wohlstandsleben war vorbei. Honorare gab es
kaum
noch. Hier und da ein Artikel in der Exilpresse, dann und wann eine
Shakespeare-Übersetzung.
Die Herweghs mussten ihre Bibliothek, die Kunstwerke, die Möbel
verkaufen.
Und doch: Emma Herwegh war stolz darauf, dass sich »der
Lebendige«
nicht wie andere ehemalige Achtundvierziger wenden und verwenden
ließ.
Als ein lukratives Angebot vom Herzog aus Weimar eintraf, hieß
es:
»Von Fürsten wird nichts genommen!« Lieber schnorrte
und
pumpte sie hinter dem Rücken ihres Mannes den Unterhalt für
die
Familie zusammen.
Trotz der Misere gelang es ihr, inzwischen im Zürcher Exil, noch
einmal
einen großen Salon zu führen. Gottfried Keller, Richard
Wagner,
Gottfried Semper, Ferdinand Lassalle, Gräfin Sophie von Hatzfeld
und
viele andere waren ihre Gäste. Vor allem aber Emigranten aus ganz
Europa,
darunter viele Italiener. Felice Orsini, Giuseppe Mazzini, Vittorio
Imbriani,
Piero Cironi – bei ihr liefen die Fäden zusammen. Emma
übersetzte
Giuseppe Garibaldis Schriften, warb deutsche Freiheitskämpfer
für
sein Heer, gab ihnen Italienischunterricht, sammelte Spenden und
schmiedete
mit Ferdinand Lassalle und dem Guerillakriegsexperten Wilhelm
Rüstow
Pläne für die Erstürmung des Vatikans…
Wedekind kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Und noch immer ist
Emma
Herwegh, die vom Sprachunterricht lebt (auch von einer kleinen
Zuwendung
der deutschen Schiller-Stiftung), in der Pariser Gesellschaft eine
geachtete
und einflussreiche Persönlichkeit. Wedekind muss später
bekennen,
er verdanke ihr so »ziemlich alles«, was er »in Paris
Gesellschaftliches
kennengelernt und genossen« habe. Ihre Beziehung gewinnt eine
für
damalige Verhältnisse einzigartige Vertrautheit. Wedekind studiert
ja
gerade die Liebe und die Frauen, die Lulus und die anderen. Auch da hat
Emma
Herwegh schamlos viel zu erzählen. Zum Beispiel über ihre
oftmals
verzweifelten Versuche, freie Liebe zu leben und Treue zu retten.
Besonders
ihre Rolle in der geheimnisumwitterten
»Herzens-Affäre«
interessiert den jungen Dichter – eine Affäre, die in den
fünfziger
Jahren des 19. Jahrhunderts europaweit einen Skandal ausgelöst hat.
Alexander Herzen, der russische Schriftsteller und Philosoph, war lange
Zeit
Herweghs engster Freund, die Familien wohnten in Genf einträchtig
unter
einem Dach. So lange, bis sich zwischen Herwegh und Herzens
»engelhaft
schöner« Frau Natalie eine leidenschaftliche Beziehung
entwickelte,
die in einem Drama mit Duellforderungen, Mord- und Selbstmorddrohungen
eskalierte.
Emma, weniger die Betrogene als die Vertraute ihres liebeskranken
Mannes,
versuchte, ein Blutvergießen zu verhindern, dabei, laut Gottfried
Keller,
eine Zigarette nach der anderen »dampfend«. Am Ende trennte
sie
sich – für eine Probezeit – von Georg und fand Unterschlupf bei
ihren
italienischen Freunden in Nizza.
Fast alle dort seien bald mehr oder minder verliebt in sie gewesen,
heißt
es. Ob ihr größter Verehrer, der Revolutionär und
Bombenleger
Felice Orsini, ihr Geliebter war, wie alle Welt meinte, verrät sie
Wedekind
nicht. Verbürgt ist nur, dass sie Orsini 1856 aus dem Kerker von
Mantua
befreite. Sie schmuggelte ein Buch mit Feile in die Zelle sowie einen
Mantel,
dessen Knöpfe mit Opium gefüllt waren, um die Wärter zu
betäuben.
Bis zu ihrem Tod bewahrte sie seinen von ihr gefälschten Pass auf,
dazu
ein Medaillon und eine Locke des Freundes, der 1858, nach einem
Attentat
auf Napoleon III., unter dem Fallbeil gestorben war.
Zwei Jahre hielten es Georg und Emma Herwegh ohneeinander aus – dann,
seit
Mai 1853 lebten sie wieder zusammen, überzeugt von der
Unverbrüchlichkeit
ihrer Liebe.
Gegen das fatale deutsche Kaiserreich, das
»Reich
der Reichen«
Für Emma Herwegh ist der junge Wedekind ein Geschenk des Himmels.
Sie
zeigt ihm alles, was sie von und über Herwegh hat. Zensierte,
beschlagnahmte
Schriften, die ungedruckten Manuskripte; er war ja keineswegs
verstummt,
wie gern behauptet wurde. Wedekind muss an den eigenen Vater denken,
der
1848 auch auf der »richtigen Seite« gestanden hat und nach
Amerika
geflohen ist. Der wie die Herweghs ein Leben lang an Deutschland litt
und,
als Bismarcks Blut-und-Eisen-Politik das Reich geschaffen und das freie
Deutschland
endgültig zerstört hatte, angewidert mit der Familie ein
zweites
Mal ausgewandert war, diesmal in die Schweiz.
Wedekind bewundert Herweghs Konsequenz, dessen Attacken gegen das
imperialistische
»Kriegsidiotentum«, gegen die lächerliche
mittelalterliche
Kaiserattrappe und das »Reich der Reichen«, in dem
Demokraten
unterdrückt und die Armen »verkauft und verraten«
waren
und es immer noch sind. Und er hält das Versprechen, das er seiner
alten
Freundin gegeben hat. Zurück in Deutschland, setzt er alles daran,
einen
Verleger für Herweghs Werke zu finden. Das dauert. Erst 1909
erscheint
die Ausgabe bei Bong in Berlin. Doch zuvor schon, 1896, eröffnen
Wedekind
und Albert Langen ihre Zeitschrift Simplicissimus, die zum
bedeutendsten
deutschen Satireblatt der Kaiserzeit werden sollte, mit Herweghs
verbotenen
Versen. Langen hat dank Wedekinds Vermittlung den Nachlass aufgekauft.
Eine
besondere Genugtuung aber ist es für Emma Herwegh, dass im selben
Jahr
ihre Geschichte der deutschen demokratischen Legion endlich in
Deutschland
erscheinen kann.
Acht Jahre später stirbt sie, am 24. März 1904 in Paris.
Neben
ihrem Mann wird sie beigesetzt, auf dem Friedhof von Liestal bei Basel,
in
der Schweiz. Ihre letzte Ruhestatt, so hatten sie es sich geschworen,
dürfe
nur in einem demokratischen Land liegen. In freier Erde.
(c) DIE ZEIT 18.03.2004 Nr.13